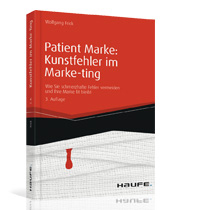Wir lesen und hören es in den Medien immer wieder: In der heutigen Hochgeschwindigkeitsgesellschaft sind Entscheider gefragt. Dynamische Berufstätige mit Tat- und Entscheidungskraft also. Auf Erfolgreiche Exemplare dieser Gattung werden denn auch Hohelieder gesungen, nicht selten erhalten Sie publizistischen Heldenstatus.
Leuchtet ja auch ein: Es sind Menschen, die Unternehmen durch die stürmischen Wirtschaftszyklen navigieren und Produkten Glitzer und Glamour bescheren. Stets nach dem Motto: Besser eine schnelle Entscheidung fällen, auch wenn sie mal nicht hundertprozentig richtig ist. Nachkorrigieren lässt sich ja später noch. So jedenfalls lautet die Theorie fürs Management. Denn: Wer sich heute zu langsam bewegt, wird von der Konkurrenz gnadenlos einge- und überholt. Was ein grundsätzliches Problem der Entscheidungsfindung heute zeigt: Der Druck auf Entscheidungsträger nimmt laufend zu. Sei es durch überh.hte Erwartungen, sei es durch ökonomische Ziele. Wie aber steht es um die Entscheidungsträger abseits des Scheinwerferlichts wirklich. Wo sind sie, diese Giganten der Entscheidungen? Wenn ich den ganz gewöhnlichen Arbeitsalltag nüchtern betrachte, scheint es mir – entgegen der Berichterstattung – immer mehr Leute zu geben, die sich vor klaren Ansagen drücken. Warum bloss? Meine Theorie: Sie fürchten sich vor dem Scheitern – vielleicht noch viel mehr vor den drohenden Konsequenzen – und sind jobverliebt. Meist liegt das an einer Unternehmenskultur, die Fehler strikt verbietet, oder noch schlimmer: sie mit Versagen gleichstellt. Etwas, das mir nicht einleuchtet, schliesslich kann man gerade aus Fehlern sehr viel lernen. Viele Firmen aber verwehren ihren Mitdenkenden und Mitarbeitenden genau das. Was, wie meist im Leben, einen ökonomischen Grund hat: In einer Zeit, in der gleiche Produkte und Dienstleistungen immer gleicher werden, wird der Preis zum Zünglein an der Waage des Kaufentscheids. Was nichts anderes heisst, als dass die Margen der Unternehmen immer kleiner werden. Und damit auch die Manövriermasse für Fehlentscheidungen, die das Unternehmen selbst verantworten muss. Und wer will schon für ein sinkendes Schiff verantwortlich sein, zumal sich die Presse mit Heisshunger auf solche Geschichten stürzt. Schliesslich ist auch das eine Entscheidung der Medien: Wo es Lichtgestalten gibt, brauchts auch ein paar Bösewichte. Aber natürlich gibt es für den Mangel an starken Entscheidern noch andere Gründe. Beispielsweise beobachte ich, dass viele Vorgesetzte höchst ungern entscheidungsfreudige Menschen einstellen. Die könnten ja womöglich Erfolg haben und damit an ihrem eigenen Stuhl sägen. Es gibt also unterschiedliche Gründe, weshalb heute nur zögerlich entschieden wird. Die meisten davon sind mit Sicherheit falsch.
Oft sind Entscheidungsträger das Problem und nicht die Lösung
Eine kleine Wortspielerei zum Thema «Entscheidungsträger». Auch wenn ich das mit einem kleinen Augenzwinkern erzähle, so steckt darin ein Kern Wahrheit. Schliesslich sagt ein Wort manchmal mehr als tausend Erfolgsbilder. Weshalb Sie nachher auch verstehen werden, dass ich mich nie als Entscheidungsträger bezeichne …
Meine Definition eines Entscheidungsträgers
Entscheidungen werden getragen und getragen und getragen, bis sie verschleppt und nicht mehr aufzufinden sind. Keine Entscheidung heisst: Alles bleibt beim Alten – wir haben es schliesslich schon immer so gemacht.
Vorteil: Man macht keine Fehler.
Nachteil: Man bringt sich um potenzielle Erfolge.
Meine Definition eines Entscheidungsfällers
Entscheidungen werden getroffen, eingehalten und umgesetzt.
Vorteil: Hier geht was auf allen Ebenen, denn Entscheidungskraft wird vorgelebt.
Nachteil: Man kann auch mal falsch liegen. Das amüsiert dann zwar statische Entscheidungsträger, kann Unternehmen jedoch eine Lernkurve bescheren, die es immer besser performen lässt.
Denn es gibt Unternehmen, die sich einmal monatlich die Zeit nehmen, und zwar durch alle Hierarchien, um begangene Fehler zu analysieren und die Lehren daraus zu ziehen. So werden Firmen schneller besser und profitabler. Dazu aber braucht es eine Unternehmenskultur, die Fehlentscheidungen nicht nur duldet, sondern als Chance akzeptiert. Noch eine Wortspielerei, die uns in der Geschäftswelt inspirieren könnte: VerANTWORTung heisst nichts anderes, als dass Menschen in Führungspositionen auf alles eine Antwort wissen müssen. Und wenn man selbst mehr Fragen als Antworten auslöst, sollte man sich selbstkritisch fragen, ob man(n oder Frau) noch im richtigen Sessel sitzt. Die erste Antwort kommt immer von dem, der dem Kunden gerade unmittelbar in die Augen schaut. Dann wird Verantwortung gelebt und wahrgenommen und macht Sinn (= Stellenbeschreibung Ist Nicht Notwendig). Nur «nach oben» delegieren ist nicht die Lösung. Je mehr Antworten jemand geben muss, desto besser sollte er bezahlt werden. Die letzte Antwort kommt hingegen immer vom Chef. Eine Führungsstufe darunter braucht es Verantwortende, also Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und wer ins Berufsleben einsteigt, sollte idealerweise ein VerFRAGEnder sein. Über die Jahre können wir so Wissen ansammeln, das uns immer häufiger Antworten finden lässt. Und wer in seinem Verantwortungsbereich immer mehr Fragen beantworten kann, steigt unweigerlich in der Hierarchie auf – bis zur Gretchenfrage. Was will ich mal werden: Entscheidungsträger oder Entscheidungsfäller? Was zeigt, dass die oberste Führungsriege dazu verurteilt ist, Antworten und Entscheidungen zu liefern. Denn nur das zählt am Ende des Tages. Warum ich mich bei den Verzögerungstaktikern manchmal frage, wofür sie eigentlich honoriert werden. Vielleicht sollten wir ja über ein Entlohnungssystem nachdenken, das sich an gelieferten Antworten orientiert.
Entscheiden mit dem Weihnachtsmannprinzip
Während vieler Jahre habe ich ein weihnachtliches Hobby gepflegt. Ich verkleidete mich als Nikolaus und besuchte Anfang Dezember jeweils Hunderte von Kindern – im Auftrag ihrer Eltern. Dabei fielen mir zunehmend Gemeinsamkeiten mit dem Wirtschaftsleben auf: Entscheidungen werden delegiert, Lösungen im Outsourcing gesucht.
Das Weihnachtsmannprinzip
- Die Eltern (= Geschäftsleitung oder oberste Führungsebene)
- bestellen einen Nikolaus (= externer Berater)
- mit der Erwartung, dass sämtliche Erziehungsfehler (= Führungsfehler)
- ohne Kenntnis der Familientradition (= Unternehmensphilosophie)
- und internen Geschichten (= Arbeitsklima)
- ausgebügelt werden.
- Als Instrument dient Drohung (= Warum sind Sie auf unserer Gehaltsliste?),
- ohne die Erziehungsmethoden (= Führungsstil)
- der Eltern (= Auftraggeber)
- zu hinterfragen.
Was dabei herauskommt, weiss ich aus Erfahrung von über 500 Nikolaus-Einsätzen: Es wirkt kontraproduktiv, weshalb ich diese Rolle heute auch anders interpretiere. Aber das gehört nun wirklich nicht hierher. Denn die Rede ist von der Not, nicht stundenlang um Entscheidungen herumzureden, sondern Schönrednern die Sprechzeit zu verkürzen und ewigen Bedenkenträgern Mut zu machen. Was es heute braucht, sind Menschen, die Szenarien voraussehen, antizipieren und entsprechend entscheiden können. Dazu sind zwei Dinge vonnöten: Eine Führungsriege, die das nicht nur zulässt, sondern fördert. Und von jedem einzelnen Player die gnadenlose ehrliche Selbsteinschätzung, was man nun wirklich ist und sein will: Entscheidungsträger oder Entscheidungsfäller?
Entscheidungseffizienz durch Vertrauen
«Vertrauen? Sie wollen, dass ich jemandem vertraue? In welcher Welt leben Sie eigentlich? Die Zeiten, als ich nachts einen 100-Mark-Schein vor meine Haustüre legen konnte, um ihn am nächsten Morgen im Briefkasten zu finden, sind Geschichte. Ehrliche Mitmenschen, die das Geld ohne Zaudern zurückgeben, die gibts doch nicht mehr.» So denken heute viele. Ein Blick in den Geschäftsalltag bestätigt das. Menschen, die für das gleiche Unternehmen tätig sind und dementsprechend die gleichen Ziele verfolgen sollten, arbeiten nach Lust und Laune gegeneinander. Manager nennen das dann «gesunden Konkurrenzkampf». Was aber soll daran gesund sein? Will ein Unternehmen Erfolg haben, muss ein Team funktionieren wie eine Fussballmannschaft. Elf Freunde, die ein Ziel verfolgen. Eine Karriere lang. So wie sich Steven Gerrard mit dem FC Liverpool, Francesco Totti mit der AS Roma oder Ryan Giggs mit Manchester United identifizierten. Nur: Selbst dieses Klischee stimmt längst nicht mehr. Jeder Fussballprofi ist zur eigenen Marke geworden, die während der Saison inszeniert werden muss, damit zum Ende der Spielzeit ein neuer, noch lukrativerer Vertrag herausspringt. Mitspieler können da nur stören. Teamgeist? Wen interessiert das noch. Christian Vieri als Paradebeispiel. Erinnern Sie sich noch an den italienischen Nationalspieler? Und für welche Klubs er gespielt hat? Nun, an eines der 15 Teams werden Sie sich wohl noch erinnern. Praktisch jede Saison ein neuer Klub. Nur einem blieb er treu: dem mediterranen Lebensraum. Seien wir keine Träumer. Heute ist sich jeder selbst am nächsten. Eigeninteressen dominieren. Das ist nicht wirklich neu. Was ich sehr bedauere: Menschen begegnen heute neuen Arbeitskollegen und Freunden mit Misstrauen. Wen wunderts? Die Medien schlachten sie genüsslich aus, die Geschichten über Betrügereien, Affären, Seitensprünge und Schlammschlachten. Da hören Hinze und Kunze gerne hin, werden aber zunehmend kritischer und verschlossener. Wer heute auf Reisen geht, erkundigt sich erst mal nach Sicherheitsvorkehrungen und Kriminalitätsrate. Und am Arbeitsplatz nutzen nicht wenige Vorgesetzte ganz gezielt die Angst vor Stellenverlust, um Mitarbeiter zu manipulieren. All das hat Folgen: Vertrauen ist zu einer raren «Ressource» geworden. Vielleicht ist sie sogar noch knapper als die Zeit, die uns sowieso immer fehlt. Dabei ist Vertrauen – und das in Geschäfts- wie Privatbeziehungen – eine der wichtigsten Zutaten zum langfristigen Erfolg. Nur wer seinem Partner oder Team vertrauen kann und nicht immer alles kontrollieren muss, ist in der Lage, schnell zu handeln. Und was gibt es in unserer schnelllebigen Zeit Wichtigeres, als der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein? Eben. Vertrauen also zahlt sich aus. Das leuchtet ein, wenn wir darüber nachdenken. Schliesslich schätzen Mitarbeiter ein vertrauensvolles Klima. Wenn ein Unternehmen offen und fair handelt, kommuniziert und entlohnt, solidarisieren sich Arbeitnehmer mit ihrer Firma. In guten wie in schlechten Zeiten. Das reduziert die Fluktuationsrate, was kein zu vernachlässigender Kostenfaktor ist. Damit sollte eigentlich auch dem letzten Skeptiker klar werden, dass effiziente Führung ohne Vertrauen gar nicht möglich ist.